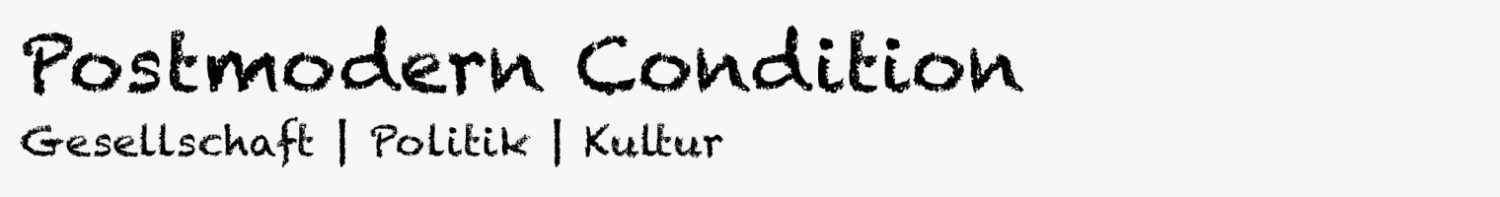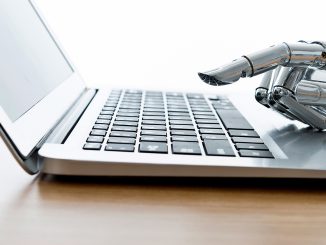Die menschliche Vernunft verliert ihr Privileg. Wenn künstliche Intelligenz jene Fähigkeiten übernimmt, die wir einst für unser geistiges Alleinstellungsmerkmal hielten, entsteht eine Kränkung, die tief ins Selbstverständnis greift: Wir erkennen uns plötzlich im Funktionieren der Maschinen wieder.
Als Sigmund Freud im Jahr 1917 von den drei grossen Kränkungen der Menschheit sprach, entwarf er nicht nur eine kulturgeschichtliche Genealogie der Moderne, sondern formulierte eine narzissmustheoretische Grundfigur: Das Subjekt verliert seine privilegierte Stellung – erst kosmologisch, dann biologisch, schliesslich psychologisch. Kopernikus entthronte den Menschen als Mittelpunkt des Universums, Darwin relativierte seine biologische Sonderstellung, Freud entzauberte das Ich als souveränen Ort rationaler Selbstführung.
Heute lässt sich mit einiger Plausibilität von einer vierten Kränkung sprechen – einer, die nicht weniger tiefgreifend ist und erneut das Selbstbild des Menschen erschüttert: die funktionale Entwertung seiner kognitiven Fähigkeiten durch die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Was bislang als Signatur genuin menschlicher Geistestätigkeit galt – Sprache, Verstehen, Kreativität, Urteilskraft –, wird zunehmend technisch reproduzierbar. Und zwar nicht als blosse Imitation, sondern als performative Konkurrenz.
Die Pointe liegt dabei weniger in den technischen Fortschritten selbst als in ihrer symbolischen Wirkung. Schon die früheren Kränkungen waren keine blossen Erkenntnisse, sondern seismische Verschiebungen im Verhältnis des Menschen zu sich selbst. So auch hier: Die Kognition, lange letzte Bastion anthropologischer Exklusivität, gerät ins Wanken. Maschinen lösen Aufgaben, schreiben Essays, komponieren Musik, führen Gespräche – und sie tun es in einer Weise, die den Unterschied zwischen original und artifiziell zunehmend verwischt.
Die eigentliche Zumutung besteht darin, dass sich der Mensch in dem erkennt, was ihn ersetzt. Es ist diese strukturelle Ersetzbarkeit, die als narzisstisches Trauma wirkt. Die KI muss kein Bewusstsein haben, keine Intention, keine Ethik – entscheidend ist, dass ihre Leistungen als funktional äquivalent erscheinen. Der Mensch verliert nicht seine Intelligenz, aber er verliert ihre exklusiv definierende Kraft. Was bleibt, ist eine differenztheoretische Ratlosigkeit.
Die soziologische Relevanz dieses Prozesses liegt auf der Hand: Wir beobachten nicht nur einen Wandel technischer Verhältnisse, sondern eine Verschiebung symbolischer Ordnung. Die Kategorie des Menschlichen, wie sie sich in der Moderne herausgebildet hat – als reflexives, vernunftbegabtes Subjekt –, wird brüchig. Das epistemische Zentrum verlagert sich, ohne dass ein neues sinnstiftendes Koordinatensystem bereitstünde.
Zugleich verdichtet sich mit der vierten Kränkung eine ambivalente Gegenwartserfahrung: einerseits Faszination angesichts technologischer Möglichkeiten, andererseits ein diffuses Unbehagen – weniger über Kontrolle oder Datenschutz, als über Identität. Die Frage «Wer sind wir, wenn Maschinen tun, was uns ausmacht?» verweist nicht nur auf ethische, sondern auf anthropologische Ungewissheiten. In Zeiten prekärer Arbeitsverhältnisse und sozioökonomischer Entsicherung gewinnt diese symbolische Entwertung zusätzlich an Sprengkraft.
Freilich gibt es philosophische Einwände. KI, so wird betont, sei syntaktisch, nicht semantisch operativ; sie verstehe nicht, was sie produziert. Sie sei ohne Intentionalität, ohne Weltbezug, ohne Leib. Diese Differenzen sind real – aber sie beruhigen nicht. Denn wie schon bei der kopernikanischen Wende liegt das Erschütternde nicht in der Sache selbst, sondern in der Wirkung auf das Selbstverständnis. Die Erde verlor ihre Mitte, nicht ihre Funktion. So verliert auch der Mensch mit der KI nicht seine Fähigkeit zu denken – aber deren symbolisches Monopol.
Soziologisch stellt sich damit eine alte Frage neu: Was konstituiert das Soziale, wenn der Mensch nicht mehr unhintergehbar als Mass seiner selbst gilt? Was bedeutet Subjektivität, wenn sie nicht länger durch kognitive Alleinstellungsmerkmale geschützt ist? Und wie verhält sich Gesellschaft zu Technologien, die ihre symbolischen Ordnungen destabilisieren, ohne sie (noch) ersetzen zu können?
Vielleicht steht eine Phase der Resymbolisierung bevor – vergleichbar mit dem Übergang von der Vormoderne zur Moderne. Nicht im Sinne einer neuen Anthropozentrik, sondern im Versuch, das Humane jenseits exklusiver Zuschreibungen zu denken: relational, situiert, geteilt. Eine solche Verschiebung eröffnet – so die Hoffnung – nicht das Ende des Humanen, sondern dessen kritische Refiguration. Nicht als Abgrenzung gegenüber Tier, Trieb oder Technik, sondern als Anerkennung von Kontinuitäten, ohne auf Differenz zu verzichten.
Die vierte Kränkung wäre dann nicht das Menetekel einer posthumanen Dystopie, sondern ein Anstoss zur Revision eines Menschenbildes, das weniger auf narzisstischer Unverwechselbarkeit als auf dialogischer Reflexivität gründet. Eine Soziologie, die diesen Prozess begleitet, müsste nicht nur technische Artefakte analysieren, sondern auch symbolische Ordnungen, Affektlagen und institutionelle Bruchlinien. Denn die Frage, was der Mensch ist, war nie nur eine philosophische – sie war immer auch eine politische. Und wird es bleiben.