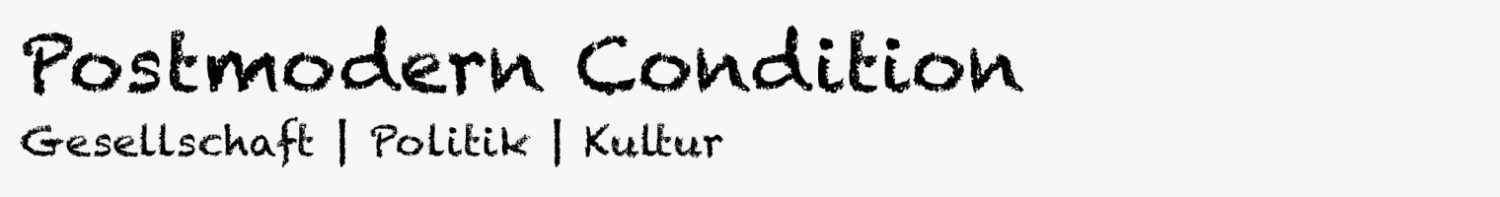Wer Trump ideologiekritisch liest, sieht weniger die Person als die Funktion. Als Charaktermaske verkörpert er jene spätkapitalistische Konstellation, in der Unternehmerfigur, Populismus und medialer Spektakelwert zu einer einzigen Rolle verschmelzen.
Der Begriff der Charaktermaske dient in der marxistischen Theorie dazu, individuelle Akteure nicht als autonome Subjekte, sondern als personifizierte Träger gesellschaftlicher Funktionen zu begreifen. Er lenkt den Blick weg vom individuellen Wollen und Handeln hin zur strukturellen Determination. Der Unternehmer, der Politiker, der Arbeiter – sie alle sind nicht bloss Berufe oder Identitäten, sondern Ausdrucksformen eines tieferliegenden Systems, das sich durch sie hindurch artikuliert. Diese Perspektive löst das Individuum als Erklärungsmuster auf – was bleibt, ist die Figur als verdichtete Struktur.
Wie verändert sich unser Blick, wenn wir Donald J. Trump nicht als Anomalie, sondern als Charaktermaske des spätkapitalistischen Systems begreifen? Ihn auf diese Weise zu lesen, heisst, ihn nicht bloss als individuelles Phänomen zu deuten, sondern als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse – als Träger einer Funktion, die in einem bestimmten historischen Moment des Kapitalismus notwendig wird. Der Begriff der Charaktermaske bezeichnet genau dies: gesellschaftlich zugewiesene Rollen, die Individuen im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise übernehmen – nicht aus freiem Willen, sondern infolge struktureller Bedingungen. Der Kapitalist ist in dieser Perspektive nicht deshalb Kapitalist, weil er bestimmte persönliche Eigenschaften besitzt, sondern weil er die Funktion des Kapitals verkörpert. Er tritt uns als Person entgegen, doch was durch ihn hindurchwirkt, ist eine gesellschaftliche Struktur.
Donald Trump erscheint in diesem Licht nicht primär als Unternehmer, Politiker oder Celebrity, sondern als Schnittmenge eben jener Sphären, die sich im neoliberalen Spätkapitalismus zunehmend überlagern. In seiner Präsidentschaft verschmilzt das Auftreten des Unternehmers mit der Pose des populistischen Anführers: Der Staat wird zur Firma, der Präsident zum Geschäftsführer, der verspricht, die «Marke Amerika» wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Diese Selbstinszenierung ist kein Zufall, sondern hat eine systemische Funktion. Trump übernimmt die Rolle einer Charaktermaske, die den Kapitalismus nicht in seiner produktiven, sondern in seiner spekulativen, entgrenzten Gestalt verkörpert – als Show, als Performance, als fortwährende Inszenierung eines Erfolgs, der sich weniger aus realen Produktionsverhältnissen speist als aus medialer Sichtbarkeit und symbolischem Kapital.
Zugleich präsentiert sich Trump als Gegenfigur zum politischen Establishment – als dezisionistischer Regelbrecher, der gerade durch Grenzüberschreitungen «authentisch» wirken will. Diese Authentizität ist selbst Teil der Maske: keine blosse Täuschung, sondern eine ideologische Operation, die über Tabubrüche, rhetorische Unmittelbarkeit und kalkulierten Kontrollverlust Nähe suggeriert. Marxistisch betrachtet handelt es sich um eine Verschiebung der ideologischen Form: Die Maske des «einfachen Volkes», getragen von einem Milliardär, funktioniert nur, weil sie die ökonomische Realität verschleiert. Trumps Politik begünstigt exakt jene Schichten, gegen die er sich rhetorisch positioniert – ein Schauspiel, das bestehende Machtverhältnisse unter dem scheinbaren Vorzeichen ihres Bruchs stabilisiert.
Dass Trump sich als Selfmade-Man inszeniert, fügt sich nahtlos in die ideologische Matrix des Neoliberalismus, in der individuelle Leistung über gemeinschaftliche Strukturen triumphieren soll. Er verkörpert das Ideal des Unternehmers – eine Figur, die zugleich Aufstiegshoffnungen nährt und Abstiegsängste kanalisiert. Doch auch diese Maske ist nicht zufällig gewählt: Sie stabilisiert ein System, in dem Subjekte sich selbst zur Ware machen müssen, um als erfolgreich zu gelten – ein System, das prekäre Lebensverhältnisse durch die Erzählung persönlicher Verantwortung legitimiert. Trumps Erfolg steht exemplarisch für eine internalisierte Marktlogik, deren härteste Spielarten unter dem Signum der Freiheit erscheinen.
Donald Trump ist, würde Marx sagen, folglich keine Anomalie des Kapitalismus, sondern dessen logische Zuspitzung. Er ist nicht der «falsche» Präsident, sondern eine Maske, die das System in einem Moment der Krise trägt – ein Gesicht eines Systems, das sich in all seinen möglichen Formen ausprobiert, bevor es endgültig untergeht. In diesem Sinn ist er eine Figur, die weniger durch ihre Individualität besticht als durch ihre strukturelle Notwendigkeit.
Die Perspektive der Charaktermaske lädt nicht zur Entmoralisierung ein, wohl aber zur Entpsychologisierung politischer Urteile. Sie erlaubt es, hinter der Person das System zu erkennen – nicht, um Verantwortung zu relativieren, sondern um ihre Bedingungen zu begreifen. Wer Trump als blossen Fehlgriff, als Abweichung oder moralisches Problem versteht, verkennt die strukturelle Logik, die ihn hervorgebracht hat. Eine ideologiekritische Analyse fragt nicht nur nach dem Wer, sondern nach dem Warum: Warum wird eine Figur wie Trump wählbar? Warum erscheint ihre Pose des Regelbruchs als Hoffnung auf Erneuerung? Und warum wird gerade das als authentisch empfunden, was am stärksten inszeniert ist?
Solche Fragen führen weg von der Fixierung auf individuelle Merkmale und hin zu einer Kritik der gesellschaftlichen Form, in der solche Figuren notwendig werden. Trump als Maske des Kapitals zu lesen, heisst daher auch: die Personalisierung politischer Konflikte zu durchbrechen – und stattdessen die Kräfte sichtbar zu machen, die durch die Personen hindurch wirksam werden. Erst so kann Kritik systemisch sein – und nicht nur symptomatisch.
(Bild: Steve Christensen / iStock.com)